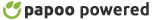8.12.2024
Neuzeitliche Kontroversen zu Politik und Kirche (3)
Vom naturrechtlichen Gemeinwesen zum demokratischen Rechtsstaat (1613)
Ein Gastbeitrag von Hubert Hecker
I. Martin Luther entwickelte aus seinen theologischen Grundsätzen eine theokratische Staatskonzeption.
Protestantische Argumente für absolutistische Herrscher
Der Reformator lehnte eine Weltbeschreibung mit säkularen Kategorien von Philosophie und Staatsrecht ab. Politik und Staat sollten allein aus der Bibel erklärt werden (sola scriptura). Bei diesem Ansatz war der Ausgangspunkt für Luthers theokratische Staatslehre die Stelle im Römerbrief 13,1: „Alle (politische) Gewalt geht von Gott aus“. Die Lutheraner interpretierten diesen Satz als unmittelbare Herrschaftsübergabe. Danach übt jeder Herrscher von „Gottes Gnaden“ seine Gewalt als Beauftragter Gottes aus. Sie sollten die nach dem Sünderfall völlig verderbte Menschheit – natura korrupta als anthropologische Grundannahme Luthers - in Zucht zu nehmen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sollten die politischen Machthaber sowohl die Strafgewalt über die weltlichen Handlungen ihrer bedingungslos abhängigen Untertanen haben als auch über deren Gewissen und Religion bestimmen können.
1598 schrieb der damals noch schottische König Jakob IV. (ab 1603 auch englischer König als James I.) im Sinne der lutherischen Weltsicht ein staatsrechtlich-theologisches Werk zum göttlichen Recht der Könige.i Dabei bezog sich der royale Autor sowohl auf den sogenannten Unmündigkeitsstatus des Volkes sowie auf die Körperanalogie von Gemeinwesen und König als Haupt. Beide Argumentationslinien verwendete er, um damit seine vom Volk losgelöste Königsherrschaft zu beweisen: „Die Könige haben ihre absolute Verfügungsgewalt über das Volk, da dieses nur ein Körper ohne Haupt darstellt, der sich nicht selbst regieren kann.“ii Wegen des nicht zum Handeln fähigen Volkskörpers könne es auch keinen Vertrag des Volkes mit dem Haupt und Herrscher geben. Die Macht des Königs könne daher nicht aus dem Volk kommen und erst recht nicht vom Volk übertragen werden, sondern sie sei ihm direkt von Gott gegeben. Daraus folge, dass der Herrscher als Statthalter Gottes nur dem Schöpfer, nicht dem Volke rechenschaftspflichtig sei. Selbst ein degenerierter König, also ein Tyrann, müsse für das Volk unantastbar bleiben. Er würde seine Strafe durch Gott selber erhalten. Für diese Auslegung berief sich James auf den Römerbrief des Paulus. Dabei erinnerte er daran, dass Paulus den Gemeindebrief unter Neros Tyrannei geschrieben habe und damit auch Gehorsam gegenüber dem Tyrannen gefordert hätte. Da die Fürsten für die weltlichen und geistlich-moralischen Belange der Untertanen eingesetzt seien, wären sie folglich auch Oberhaupt der jeweiligen Landeskirchen. Von seinen englischen Untertanen verlangte König James I. 1604 einen Eid, der sie sowohl in ihren weltlichen Belangen als auch in ihren Gewissensfragen an den König binden sollte.iii
(Die absolutistische Staatslehre des englischen Stuart-Königs entwickelte 50 Jahre später Thomas Hobbes nach den englischen Bürgerkriegen weiter. Mit seiner These, dass in naturwüchsigen Gesellschaften „der Mensch dem Menschen ein Wolf“ sei, knüpfte er zwar an die pessimistische Anthropologie Luthers an, begründete solches menschliche Verhalten aber aus den unsicheren Rechtsverhältnissen. Eben deshalb müssten die Menschen durch einen absolutistisch herrschenden Monarchen regiert werden, der innergesellschaftliche Sicherheit und Frieden gewährleiste, auch indem er als geistliches Oberhaupt seiner Landeskirche eingesetzt sei. Neu war Hobbes‘ Argumentation, dass die Menschen aus Vernunftgründen in einem Gesellschaftsvertrag alle ihre individuellen und kollektiven Selbstverwaltungsrechte bedingungslos auf den Herrscher übertragen und damit den absolutistischen Herrscher legitimieren würden. Allerdings bleibt er die Frage schuldig, wie mit dem Machtmissbrauch eines „wölfischen“ Herrschers als Tyrannen umzugehen wäre, da Hobbes ein Widerstandsrecht der Untertanen kategorisch ausschließt. Dieses staatsrechtlich-politische Problem ist erst 40 Jahre später von John Locke gelöst worden mit seiner Lehre, dass die Menschen im Gesellschaftsvertrag nur die Gewaltausübungs- und Verwaltungsrechte an den Herrscher bzw. Staat abgeben, aber ihre individuellen Menschenrechte behalten – und somit auch ein Widerstandsrecht gegen tyrannische Herrscher.)
II. Gegen die theokratische Anmaßung des protestantischen Staatskirchentums …
Der gelehrte Kardinal Robert Bellarmin (+1621) schrieb mehrere kontroverstheologische Abhandlungen gegen das protestantische Gottesgnadentum der Fürsten. Die politischen Verhältnisse stellte er unter dem Kapitel De laicis – über die Laien – dar und verwies damit den Staat in den weltlich-säkularen Bereich. Bei seinen Ausführungen stützte er sich weitgehend auf die naturrechtliche Staatslehre des spanischen Scholastikers Francisco de Vitorias (+1546), um die theologische Überhöhung der Staatsmacht durch die Protestanten zurückzuweisen: Das Zusammenwachsen der menschlichen Gemeinschaften betrachtete er als einen naturnotwendigen Prozess ebenso wie der Machttransfer des Selbstverwaltungsrechts auf eine oder mehrere Personen. Gegen den englischen König und die protestantische Lehre vom königlichen Gottesgnadentum stellte Bellarmin fest, dass die Macht des Herrschers nicht unmittelbar von Gott stamme, sondern nur indirekt durch das von Gott gegebene Naturrecht und nur in diesem Sinne Röm 13 zu verstehen sei. Bei der Herrschaftsbeschränkung auf den weltlichen Bereich habe der König kein Mandat über das Gewissen und die Religion der Menschen. Die kirchliche Macht des Papstes als Stellvertreter Christi dagegen stamme direkt von Gott.
… aber für das monarchische Staatsprinzip
Der Jesuit Bellarmin bestätigte und verschärfte die These des Dominikaners de Vitoria, dass die naturwüchsigen Gemeinschaften unfähig seien zur Selbstverwaltung, u. a. durch die Körperanalogie. Bei seiner weiteren Ausführung zur Machtübertragung begründet er die Monarchie als die beste Regierungsform. Sie könne den Übergang einer anarchischen, konfliktreichen Menge (multitudo) in eine geordnete, strukturierte societas am besten gewährleisten, indem nach dem hierarchischen Prinzip die Gesellschaft von oben nach unten durchgeordnet werde. Jedenfalls wäre die Demokratie wegen der Unmündigkeit der Volksmenge nicht nur unerwünscht, sondern weder effektiv durchführbar noch zielführend im Sinne des Gemeinwohls.
Die Staats- und Kirchenlehre des angesehenen Kardinals und später zum Kirchenlehrer erhobenen Theologen blieb über drei Jahrhunderte bestimmend für die Kirche. Erst Papst Leo XIII. führte mit seiner Enzyklika ‚Immortale Dei‘ die sogenannte Indifferenzlehre ein, nach der die Kirche keine Staatsform bevorzugt oder tadelt, sofern sie „das gemeinsame Wohl und Gedeihen wirksam fördert“. Angesichts der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts hob Papst Pius XII. 1944 den positiven Wert der Demokratie als Grundlage für die Nachkriegsordnung hervor.
III. Musste die kirchliche Lehrgeschichte in diesen Bahnen verlaufen? Ideengeschichtlich hätte man sich die dreieinhalb Jahrhunderte währende Fixierung auf die monarchische Staatsform als Umweg ersparen können, wenn man in der Kirche die Staatslehre eines großen Gelehrten der europäischen Frühaufklärung zu Anfang des 17. Jahrhunderts beherzigt hätte: Der Jesuit Francisco Suárez entwickelte in seiner Schrift von 1613 als logische Folge der Naturrechtslehre die These von der
Demokratie als vernünftige und naturgemäße Form des Staates.
Die argumentative Kritik des römisch-katholischen Kardinals Bellarmin an der theokratischen Staatslehre des englisch-anglikanischen König Jakob hatten den spanischen Gelehrten herausgefordert, die offensichtlichen Ungereimtheiten der neuscholastischen Staatslehre auszuräumen.
Wie de Vitoria und Bellarmin ging auch Suárez aber von der naturrechtlichen Grundthese aus, dass die Menschen in einem natürlichen Prozess zu großen Gemeinschaften zusammenwachsen. Die hätten in ihrer Gesamtheit das Recht zur Selbstregierung inne. Denn weder die Bibel noch die Vernunft lehrte, dass ein Einzelner zur Herrschaft über die Menschen bestimmt wäre. Als Begründung führt er aus: „Es liegt in der Natur der Sache, dass alle Menschen frei geboren sind und deswegen keiner weder die Jurisdiktion noch die Herrschaft über den anderen hat und es keinen natürlichen Grund gibt, warum den einen eher als den anderen dies zugeteilt sein sollte.“iv
Dieser 1613 von dem Jesuiten niedergeschriebene Satz stand in der Tradition des spanischen Scholastikers de Vitoria von 1528 und war von Papst Paul III. 1637 in seiner Enzyklika „Sublimis Deus“ bestätigt worden. Das Theorem der von Natur aus frei geborenen Menschen bildete zugleich den Ausgangspunkt für alle weiteren bürgerlichen Staatstheorien etwa die von Thomas Hobbes (1651) und John Locke (1687) sowie die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 und die Menschenrechtserklärung der französischen Konstitution von 1791, in der es im Artikel 1 heißt: „Die Menschen sind und bleiben von Geburt an frei und gleich an Rechten.“
Suárez macht sich selbst den Einwand, ob seine Beweisführung nicht direkt zur Staatsform der Demokratie führe, also das Volk sich als Selbstregent konstituieren könnte, was bis dato als die unmögliche bzw. schlechteste Regierungsform angesehen wurde.
Entgegen den Vorgängertheorien, in denen die Herrschaftsübergabe an einen Monarchen oder mehrere Aristokraten als ein quasi naturnotwendiger Prozess dargestellt wurde, betonte Suárez die freie Entscheidung der Menschen für diese oder jene Staatsform, „da nichts in der natürlichen Vernunft deren Notwendigkeit aufzeigt“ – ein argumentativer Affront gegen Bellarmin. Eine democratia könne sogar ohne eine ausdrückliche „positive Einrichtung“ existieren, nämlich als Ausfluss der ursprünglichen Gemeinschaften. Denn die natürliche Vernunft lege uns die Annahme auf, dass die politische Regierungsgewalt eine natürliche Folge der strukturierten menschlichen Gemeinschaften sei.
Bemerkenswert ist hier, dass Suárez als Frühaufklärer mit der natürlichen Vernunft argumentiert und biblische Hinweise nur als Zusatzbeweise heranzieht. Die ‚demokratische Folgerung‘ war zwar logisch in dem naturrechtlichen Ansatz enthalten, nach dem die autarke Gemeinschaft die Macht zur Selbstregierung enthält, aber die traditionelle Staatslehre hatte einige Hürden gegen die demokratische Konsequenz aufgebaut.
So waren die katholischen Vorgänger Suárez‘ zu dem gleichen Ergebnis der Inthronisierung eines Monarchen gekommen wie die Protestanten, nur eben von Seiten des Volkes eingesetzt. Ebenfalls waren die Gründe für den Vorrang des monarchischen Prinzips ähnlich: Der protestantischen Einschätzung von dem verderbten oder wölfischen Charakter der Menschen entsprach auf katholischer Seite die vorherrschende Meinung über die Unmündigkeit und Unfähigkeit zu gemeinschaftlichem Austausch, Willensbildung und Selbstorganisation der Menschen in der ursprünglichen Ansammlung (lateinisch: multitudo).
Der jesuitische Gelehrte entwickelt dagegen eine neue Argumentationslinie, nach der das Volk nicht nur die Macht, sondern auch die Fähigkeit zur Selbstregierung habe. Nach seinem Traktat De legibus, einem Kommentar zum gleichnamigen Kapitel aus Thomas von Aquins Summa theologica, entlässt Gott den Menschen in die Freiheit, das heißt in letzter Konsequenz auch in die selbstbestimmte Regierung durch menschliche Gesetze. Doch diese müssten den Regeln der naturrechtlichen Grundgesetze folgen. Die sind dem Menschen „eingeschrieben ins Herz“ (lex naturalis, vgl. Röm 2,15), anders gesagt sollten sich die menschlichen Gesetze nach den Prinzipien der praktischen Vernunft (ratio naturalis) richten. Für die ursprüngliche Gemeinschaftsbildung der Menschen heißt das: „Die natürliche Vernunft leitet die Individuen an, sich zu einer communitas zu verbinden; die Vernunft ist nach katholischer Lehre durch den Sündenfall zwar geschwächt, jedoch nicht verloren. Der Mensch bleibt auch nach dem Sündenfall ein vernünftiges und damit zur Selbstbestimmung fähiges Wesen.“v
Suárez erläutert das Entstehen der geordneten communitas als Prozess in zwei Stufen: Er geht mit dem Ausdruck multitudo (Menschenmenge) der traditionellen Lehre davon aus, dass die Menschengesellschaft in ihren allerersten Anfängen eine unstrukturierte Ansammlung war, ein „Aggregat ohne jegliche Ordnung“. Die Mitglieder brächten weder eine physische noch moralische Einheit zustande und hätten deshalb auch keinen Bedarf an einer Führung. Geleitet von der Vernunftnatur der Einzelnen, treten die Menschen dann in einen Willensbildungsprozess ein, der schließlich in einem Konsens konvergiert. Dadurch konstituiert sich die communitas zu einer Körperschaft (persona ficta oder mystica). Diese politische Einheit ist hingeordnet auf den Zweck der gegenseitigen Hilfeleistung und des Gemeinwohls. Erst in diesem Stadium des Vergesellschaftungsprozesses entsteht das Bedürfnis nach einer Führung des Gemeinwesens: Die politische Körperschaft gibt sich eine Regierung.
Was die späteren Staatstheoretiker wie Hobbes, Locke und Rousseau als punktuellen Gesellschafts- oder Herrschaftsvertrag (foedus societatis) darlegen, hat der jesuitische Frühaufklärer viel realistischer und logischer als vernunftgeleiteten Prozess der Vergesellschaftung beschrieben, an deren Abschluss dann ein Herrschaftsvertrag steht.
Antike Paten für den neuzeitlichen Staat von Recht und Gerechtigkeit
Als Bedingung des Gesellschafts- und Staatswerdungsprozesses setzt Suárez voraus, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Eine vernünftige Konsensbildung ist aber nur möglich, weil die Menschen über die Einsicht in das lex naturalis oder ihre Teilhabe an der natürlichen Vernunft eine gemeinsame höchste Norm anerkennen. Die besteht nach Suarez in Recht und Gerechtigkeit. Diese Grundgedanken knüpfen an die römische Staatsdefinition von Cicero an, der in seinem Werk De re publica schreibt: „Das Gemeinwesen ist Sache des Volkes. Aber das (Staats-) Volk ist nicht jede irgendwie zusammengescharte Ansammlung von Menschen, sondern eine (strukturierte) Menge, die in der Anerkennung des Rechts und der Gemeinsamkeit des Nutzens (Gemeinwohl) vereinigt ist.“
In Ciceros Schriften kulminieren die politischen Werke Platons, auf die sich Suárez erneut und explizit bezieht.vi Seit der italienische Humanist Ficin alle Schriften Platons ins Lateinische übersetzt hatte, war dessen wachsender Einfluss auf die klassischen politischen Definitionen der Neuscholastik nachweisbar.
In der Scholastik war zwar die Unterscheidung von geistlich und weltlich angelegt, aber erst bei Suárez wird unter dem Einfluss Platons und Ciceros die Trennung der beiden Bereiche Schöpfung und Offenbarung strikt durchgeführt. Das bedeutet für ihn: Gott hat seiner Schöpfung, also der Welt und Natur, bestimmte (rationale) Gesetze mitgegeben. Insofern ist der weltliche Bereich der ratio des Menschen aufgegeben, die gesellschaftlich-politischen Entwicklungen sind auf die natürliche Vernunft gestützt zu beschreiben.
Bei Platon und Cicero findet Suarez das Modell einer Gesellschaft, die sich im Rahmen der vernunftgeleiteten Einzelnen entwickelt. Die Gemeinschaft kommt zu einem Konsens über ein gemeinsames Gutes, bei Platon die natürliche Gerechtigkeit. Sie konstituiert sich damit als Rechtsgemeinschaft und kann so eine moralisch-politische Körperschaft (persona ficta) werden.
Das aber ist die Voraussetzung für die logische Ableitung des folgenden Herrschaftsvertrages mit einer Regierung. Der Volkskörper unterwirft sich dabei dem Herrscher unter der Bedingung der von beiden zu beachtenden gemeinsamen Gerechtigkeitsnorm. Das Volk behält somit das Recht, die Einhaltung der Grundnormen zu überwachen und bei schwerwiegender und dauernder Verletzung Widerstand zu erheben.
Platons breitet in seinem Werk ‚Nomoi‘ den Gedanken der Volkssouveränität aus. Dort konnte Suárez das Funktionieren einer „natürlichen“ Demokratie studieren. Bei dem griechischen Philosophen findet er die Aussage, dass das Gesetz als „Beschluss des Volkes“ zu gelten habe.
Unter dem Einfluss Platons verändern die Staatstheoretiker in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Hauptcharakteristik des Staates von dem jus gladii, dem Schwertrecht nach innen und außen (wie noch bei de Vitoria vorherrschend), zu der potestas legis ferendae, dem Gesetzgebungsrecht: Das Gesetz bestimmt, wer das Schwert tragen darf, erklärte der französische Staatsrechtler Bodin. Auch dieses für die weitere europäische Staatslehre wichtige Theorem (vgl. Lockes rule of law) baute der gelehrte Jesuit in seine Politik-Traktate ein.
Es ist das Verdienst von Francisco Suárez, die naturrechtliche scholastische Staatslehre mit der Einarbeitung von Ciceros Schriften zu Republik und Gesetzen, aber vor allem mit Platons Werke zum Vernunft- und Rechtsgemeinschaftsstaat zu einer Grundlagentheorie für die modernen europäischen Staatstheorien gemacht zu haben (siehe oben).
Der Rückgriff auf die antiken Autoren war ein Akt der ‚guten‘ Renaissance als Rückgriff auf das antike Erbe – im Gegensatz etwa zu der staatspolitischen Schrift Il principe von Nicolo Machiavelli. Der Florentiner Autor lehnte in seinem Werk eine rechtlich-ethische Herrschaftsführung zugunsten einer bedingungslosen Machteroberung und -sicherung ab. Dabei stützte er sich hauptsächlich auf altrömische Machtspiele, Kriege und taktische Praktiken. Suárez dagegen steht für den Ansatz, bei der Sichtung vorhergehender Epochen nur das Gute zu übernehmen (vgl. 1 Thess 5,21). Dadurch ist Europa groß geworden, dass es das Beste von griechischer Philosophie und Politik sowie von Recht und Verwaltung der Römer übernommen und mit dem Geist der christlichen Nächstenliebe überformt hat.
Im Gegensatz zu seiner Wirkung auf die säkularen europäischen Staatstheorien blieben dem großen spanischen Gelehrten Suárez in der Kirche eine entsprechende Würdigung und Aufnahme seiner Lehre versagt. In den kirchlich-akademischen Kreisen setzte sich im 17. Jahrhundert die monarchisch-hierarchische Herrschaftsauffassung durch. Im 18. Jahrhundert passte man die kirchliche Politiklehre gänzlich der auf dem Kontinent vorherrschenden absolutistischen Staatslehre an. So war es nicht verwunderlich, dass Papst und Kirche in der Französischen Revolution den Übergang von der absolutistischen zur konstitutionellen Monarchie ablehnten und noch 150 Jahre brauchten, um nach dem Terror der totalitären Regimes in Europa den Wert der demokratischen Republik für Gesellschaft und Gemeinwohl zu erkennen.
I Die folgenden Ausführungen orientieren sich weitgehend an der Abhandlung von Ada Neschke-Hentschke (Lausanne):Vom Staat der Gerechtigkeit zum modernen Rechtsstaat, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie, Heft 2/2002
II Übersetztes Zitat aus King James IV. Schrift Political Writings, bei Neschke-Hentschke S. 269f
III Referiert aus der Schrift von Neschke-Hentschke S. 270
iv Zitat aus Francisco Suàrez: De legibus, 1613, bei Neschke-Hentschke S. 279
v Kommentar von Neschke-Hentschke S. 279
vi Die folgenden Ausführungen referieren den letzten Abschnitt des Aufsatzes von Neschke-Hentschke
S. 273-285